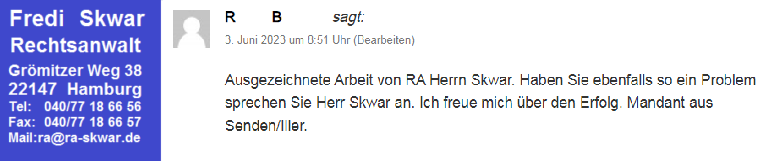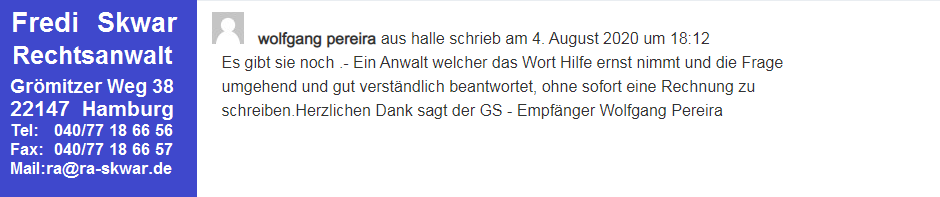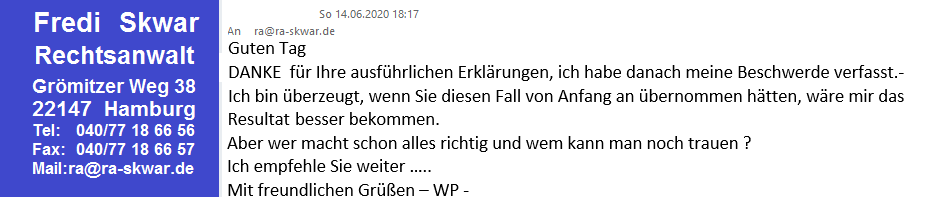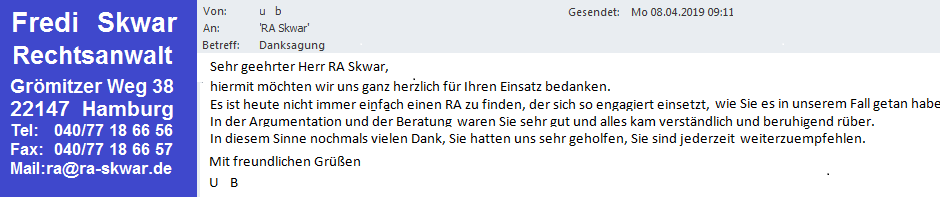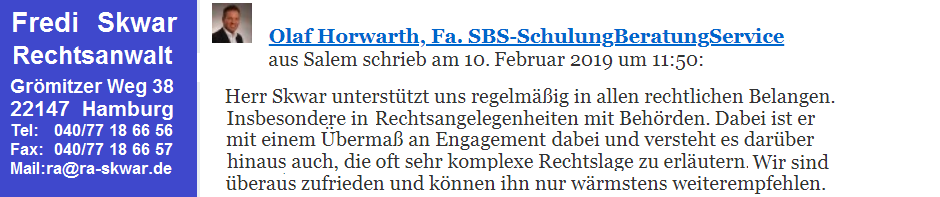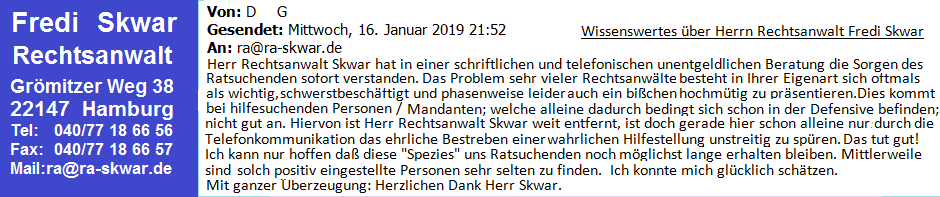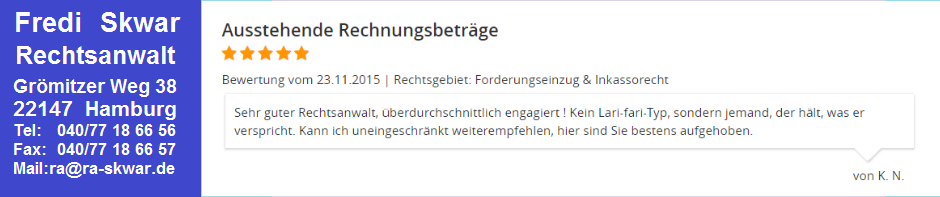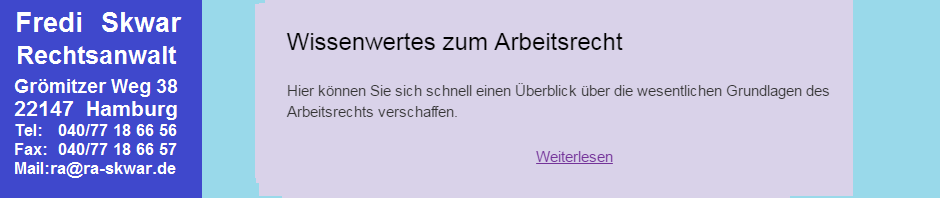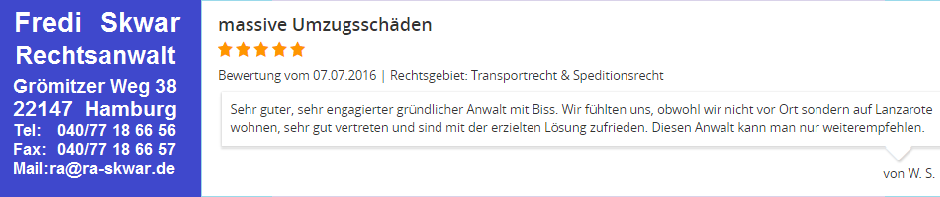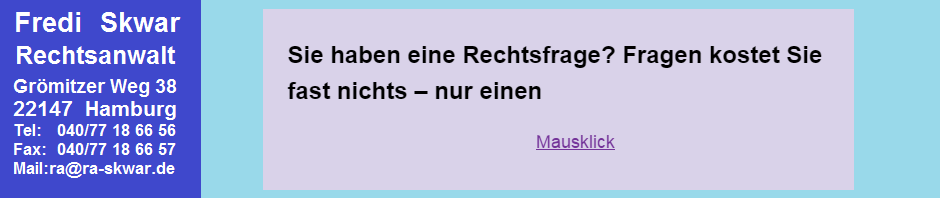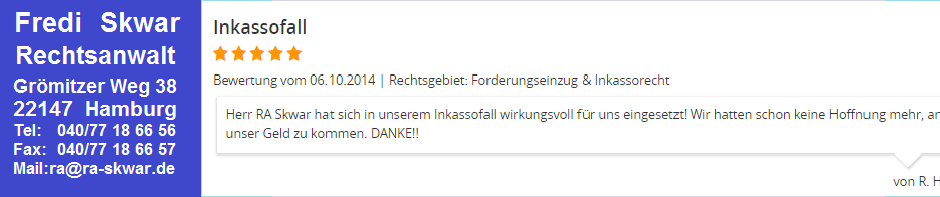LAG Nürnberg, Urteil vom 09.06.2017 – 7 Sa 231/16
Zur Haftung des Arbeitgebers für Arbeitsunfall (hier: Ansteckung des Arbeitnehmers mit Hepatits C)
Tenor
1. Das Endurteil des Arbeitsgerichts Bamberg – Kammer Coburg – vom 19.04.2016 wird abgeändert.
2. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 150.000,00 € (in Worten: einhundertfünfzigtausend Euro) zu zahlen.
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schmerzensgeldansprüche.
Die Klägerin begann am 01.10.2008 in der Praxisgemeinschaft Dr. med. U… und Dr. med. G… eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Die Ausbildung sollte zum 30.09.2011 beendet sein.
Mit Schreiben vom 05.02.2011 bewarb sich die Klägerin beim Beklagten und teilte mit, dass sie ihre Ausbildung im Juli 2011 abschließen werde. Der Bewerbung war ein Zwischenzeugnis vom 23.12.2010 beigefügt. Darin heißt es u.a.:
Sie erlernte die Labortätigkeit (Urinstatus, Blutzuckerbestimmung, Sterilisieren von chirurgischem Besteck), sehr bald konnte sie selbständig Blutentnahmen und das Anlegen von Infusionen sowie intrakutane und intramuskuläre Injektionen durchführen und zeigte dabei ein umsichtiges und sicheres Verhalten.
Unter dem 06.06.2011 vereinbarten die Parteien, das Berufsausbildungsverhältnis zwischen der Klägerin und Herrn Dr. U… mit allen Rechten und Pflichten nahtlos zum 06.06.2011 zu übernehmen.
Seit August 2006 sieht die TRBA (Technische Regelung für biologische Arbeitsstoffe) 250 verschärfte Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten vor. Diese Instrumente sind durch geeignete sichere Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Verletzungen besteht. Solche Instrumente sind insbesondere Sicherheitskanülen. Sicherheitskanülen sind mit einer klappbaren Abdeckkappe versehen, mit der die benutzte Nadel unmittelbar nach Gebrauch einhändig gesichert wird.
Die nicht mit einer derartigen Klappe versehenen Nadeln wurden mittels eines sog. Recappinggefäßes gesichert. Bei einem Recappinggefäß handelt es sich um einen kegelförmigen Ständer, der statt einer Spitze eine Öffnung enthält. In die Öffnung wird die Abdeckung für eine Nadel eingelegt. Die benutzte Nadel wird in die Abdeckung abgestreift und ist dann durch diese geschützt.
Beim Beklagten waren Sicherheitskanülen nicht im Gebrauch. Der Beklagte und seine beiden Arzthelferinnen, Frau T… und Frau H…, waren, schon bevor die Klägerin beim Beklagten die Arbeit aufgenommen hatte, übereingekommen, die bisherigen Nadeln und nicht die Sicherheitskanülen zu verwenden.
Das beim Beklagten verwendete Recappinggefäß schloss mit einer Plattform ab, die mit einem ca. 2 mm hohen Rand umgeben war und eine Öffnung enthielt (vgl. Bl. 311 ff d.A.).
Am 24.05.2011 arbeitete die Klägerin erstmals in der Praxis des Beklagten zur Probe. Frau H… begleitete den Beklagten bei der Behandlung der Patienten, Frau T… (jetzt: Frau M…) war am Empfang tätig. Frau T… war zu diesem Zeitpunkt schwanger.
Der Beklagte erteilte im Lauf des Vormittags die Weisung, von einem Patienten, der an Hepatitis C erkrankt war, Blut zu entnehmen. Die Weisung wurde über ein internes Meldesystem über die Computeranlage an Frau T… weitergegeben.
Die Klägerin führte die Blutentnahme durch. Dabei verwendete die Klägerin das Recappinggefäß. Die Klägerin stach sich die Nadel in den Finger. Dadurch infizierte sie sich mit Hepatitis C.
Die Klägerin erhob am 29.12.2014 die vorliegende Klage zum Arbeitsgericht Bamberg.
Das Arbeitsgericht wies mit Urteil vom 19.04.2016 die Klage ab.
Das Urteil wurde der Klägerin am 28.04.2016 zugestellt.
Die Klägerin legte am 19.05.2016 gegen das Urteil Berufung ein und begründete sie am 26.07.2016. Die Berufungsbegründungsfrist war bis 28.07.2016 verlängert worden.
Die Klägerin trägt vor, sie habe den Beklagten darüber informiert, dass sie bei ihrem vorherigen Arbeitgeber lediglich Blutabnahmen unter Verwendung von Sicherheitskanülen durchgeführt habe. Sie habe den Beklagten gebeten, ihr Sicherheitskanülen zur Verfügung zu stellen. Der Beklagte habe dies abgelehnt und verlangt, sie solle die Blutentnahme mit Hilfe des Vakuumsystems durchführen. Sie habe erklärt, sie fühle sich dabei nicht wohl, weil sie noch nie ohne Sicherheitskanülen Blut abgenommen habe. Der einzige Hinweis des Beklagten sei gewesen, dass sie Handschuhe anziehen solle.
Ihr sei per e-mail die Weisung erteilt worden, bei dem mit Hepatitis C infizierten Patienten im Labor Blut abzunehmen.
Die Klägerin führt unter Bezugnahme auf ein im Auftrag der zuständigen Berufsgenossenschaft erstelltes Gutachten des Universitätsklinikums Erlangen vom 25.10.2013 (Bl. 9 ff d.A.) aus, sie leide als Folge der Interferontherapie unter rheumatoider Arthritis. Damit verbunden seien Bewegungseinschränkungen und Schmerzen in mehreren Gelenken. Sie habe Schwindelattacken, Herzrasen und Konzentrationsstörungen als Folge von Durchschlafstörungen. Ferner habe sie jeden Tag Kopfschmerzen. Dadurch hervorgerufen sei eine schwere Traurigkeit bis hin zur Depression.
Die Klägerin trägt vor, sie müsse regelmäßig Pantoprazol 40 mg (jeden zweiten Tag 1x), Methotrexat (MTX) 20 mg (1x pro Woche), Folsan (1x pro Woche), Humira 40 mg (alle 14 Tage), Vitamin D, Palexia (Opiat; täglich) und Novaminsulfon 400 mg (bei Bedarf) einnehmen.
Auf Dauer sei sie nicht in der Lage, partnerschaftlich mit jemandem zusammenzuleben. Einem Kinderwunsch stehe die Einnahme von MTX entgegen. Solange sie dieses Mittel nehme, sei eine Schwangerschaft nicht möglich. Werde es abgesetzt, habe sie fürchterliche Schmerzen in den Gelenken.
Die Klägerin beantragt:
1. Das Urteil des Arbeitsgerichts Bamberg vom 19.04.2016 wird aufgehoben.
2. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichtes gestellt wird, mindestens jedoch in Höhe von EUR 50.000,–, zu bezahlen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
Der Beklagte beantragt:
I. Die Berufung wird abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Der Beklagte macht geltend, ein Haftungstatbestand sei nicht gegeben. Insbesondere liege kein Vorsatz vor. Er trägt vor, er habe die Klägerin nicht angewiesen, bei dem Patienten Blut abzunehmen, er habe lediglich eine allgemeine Anweisung erteilt.
Der Beklagte führt aus, eine Kausalität zwischen dem Unfall und den Gesundheitsbeeinträchtigungen bestehe nicht. Es gebe auch bei Jugendlichen schwere rheumatische Erkrankungen ohne erkennbare Ursache.
Der Klägerin sei ein Mitverschulden anzulasten. Sie habe beim Recapping die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet.
Der von der Klägerin geltend gemacht Betrag sei zu hoch.
Wegen des weitergehenden Vorbringens der Parteien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.
Gemäß Beweisbeschluss des Landesarbeitsgerichts Nürnberg vom 20.12.2016 (Bl. 238 d.A.) ist Frau M… uneidlich als Zeugin vernommen worden. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen (Bl. 286 bis 290 d.A.).
Entscheidungsgründe
Die Berufung ist zulässig. Sie ist statthaft, § 64 Absatz 1 und 2 b) ArbGG, sowie form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden, § 66 ArbGG.
Die Berufung ist begründet.
Die Klägerin hat gegen den Beklagten Anspruch auf ein angemessenes Schmerzensgeld, §§ 253 Absatz 2, 249, 611, 241 Absatz 2, 282, 280, 823 Absatz 2 BGB iVm Ziffer 4.1.2.8 der TRBA 250, § 104 Absatz 1 SGB VII.
Der Beklagte hat gegen ihm obliegende arbeitsvertragliche Pflichten verstoßen sowie die zugunsten der Klägerin bestehenden arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften verletzt.
Als Arbeitgeber der Klägerin oblag es ihm, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsmittel, die er der Klägerin zur Verfügung stellte, den Unfallverhütungsbestimmungen entsprachen. Dies war nicht der Fall. In der Praxis des Beklagten wurden insbesondere nicht die seit 2008 vorgeschriebenen Sicherheitskanülen verwendet. Vielmehr wurden die herkömmlichen Kanülen ohne Sicherheitsklappe benutzt und die gebrauchten Kanülen im Wege des sogenannten Recappings entsorgt.
Darüber besteht zwischen den Parteien kein Streit. Insbesondere ist unstreitig, dass der Beklagte und seine beiden Arzthelferinnen, bevor die Klägerin die Ausbildung beim Beklagten fortsetzte, übereinkamen, die nicht mehr vorschriftsmäßigen Kanülen sowie die damit verbundene Entsorgung beizubehalten.
Infolge der Pflichtverletzung hat die Klägerin eine Körperverletzung erlitten.
Die Klägerin hat am 24.05.2011 einem Patienten, der mit Hepatitis C infiziert war, mit einer herkömmlichen Kanüle Blut abgenommen und, als sie die benutzte Kanüle im Wege des Recappings entsorgte, sich in den Finger gestochen. Die Verletzung führte dazu, dass die Klägerin an Hepatitis C erkrankte.
Das Vorliegen eines Arbeitsunfalls selbst sowie die Infizierung mit Hepatitis C sind unstreitig.
Das erkennende Gericht geht auch davon aus, dass sich der Unfall so ereignet hat, wie die Klägerin ihn geschildert hat. Der Beklagte hat dies zwar zunächst mit Nichtwissen bestritten. Ob dies noch aufrechterhalten bleibt, nachdem die Klägerin in der Sitzung am 20.12.2016 an dem vom Beklagten mitgebrachten Recappinggefäß demonstrierte, wie sich der Unfall ereignete, ist unklar. Der Beklagte stützt, worauf noch einzugehen ist, hierauf seinen Einwand des Mitverschuldens der Klägerin. Im Übrigen enthält das vom Beklagten gefertigte Gedächtnisprotokoll vom 24.05.2011 (Bl. 239 d.A.) eine Bestätigung des Sachvortrags der Klägerin. Dort heißt es, bezogen auf den Umstand, dass sich die Klägerin gestochen hatte, „Dies obwohl alle Helferinnen in der Vergangenheit wiederholt auf das Verbot des recapping hingewiesen wurden“.
Die Klägerin hat über die Erkrankung mit Hepatitis C hinaus weitergehende gesundheitliche Beeinträchtigungen, die auf die Infektion zurückzuführen sind.
Infolge der medikamentösen Dualtherapie der Hepatitis C mit einem Interferonprodukt (PEG-Interferon-Alpha-2a) und Ribavirin stellte sich bei der Klägerin eine rheumatoide Arthritis ein, die bis heute anhält.
Nach Überzeugung des erkennenden Gerichts wurde diese Erkrankung durch die medikamentöse Behandlung der Hepatitis C ausgelöst.
Das erkennende Gericht folgt insoweit dem Sachvortrag der Klägerin. Es ist von der Richtigkeit der Behauptungen der Klägerin insbesondere wegen des Gutachtens des Universitätsklinikums Erlangen vom 25.10.2013 überzeugt, § 286 ZPO.
Das Gutachten wurde zwar nicht im vorliegenden Verfahren in Auftrag gegeben. Es stellt indes auch kein Privatgutachten der Klägerin dar, sondern wurde auf Veranlassung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege eingeholt. Der Beklagte erhebt gegen die Richtigkeit der gutachterlichen Feststellungen insbesondere keine Einwände.
Die Gutachter kommen zum Ergebnis, ein kausaler Zusammenhang zwischen der Hepatitisinfektion und der Interferontherapie und dem Auftreten der rheumatoiden Arthritis sei sehr wahrscheinlich. Dies wird im Einzelnen begründet, wobei einerseits darauf abgestellt wird, dass eine interferonbasierte antivirale Therapie häufig Autoimmunphänomene hervorrufe, und andererseits auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen der Interferonbehandlung und der Beschwerdesymptomatik hingewiesen wird. Auch bei Annahme einer genetischen Disposition der Klägerin geht das Gutachten davon aus, dass die Interferonbehandlung als wesentlicher Auslöser für die rheumatoide Arthritis anzusehen ist.
Andere Gründe für den Ausbruch der Erkrankung sind nicht ersichtlich. Der Einwand des Beklagten, auch Jugendliche erkrankten an Rheuma, ohne dass hierfür eine Ursache erkennbar sei, ist nicht geeignet, Zweifel an der Kausalität zwischen der Interferonbehandlung und der rheumatoiden Arthritis zu begründen. Zwar trifft es zu, dass auch Kinder und Jugendliche an Rheuma erkranken (juvenile idiopathische Arthritis). Deren Ursache ist unbekannt. Vorliegend besteht hingegen ein konkreter Auslöser für das Auftreten der Erkrankung der Klägerin. So ist, wie bereits ausgeführt wurde, die Interferonbehandlung der Klägerin häufig die Ursache für eine rheumatoide Arthritis.
Eine andere theoretisch bestehende Ursache für die Erkrankung erscheint demnach nach Überzeugung des erkennenden Gerichts ausgeschlossen.
Der Beklagte haftet für den aus diesem Unfall resultierenden (immateriellen) Schaden.
Der Haftung des Beklagten steht § 104 Absatz 1 SGB VII nicht entgegen.
Allerdings liegt ein Versicherungsfall im Sinne der zitierten Vorschrift vor. Bei der Verletzung der Klägerin handelte es sich um einen Arbeitsunfall, §§ 7 Absatz 1, 8 Absatz 1, 2 Absatz 1 Ziffer 2 SGB VII. Der Unfall ereignete sich während der Tätigkeit der Klägerin im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses.
Im Übrigen hat die Berufsgenossenschaft den Unfall der Klägerin als Arbeitsunfall anerkannt mit der Folge, dass das erkennende Gericht an diese Feststellung gebunden ist, § 108 Absatz 1 SGB VII.
Der Beklagte kann sich nicht auf das Haftungsprivileg des § 104 SGB VII berufen.
Soll das Haftungsprivileg nach § 104 SGB VII, der die Bestimmung des § 636 Absatz 1 Satz 1 RVO abgelöst hat, entfallen, erfordert dies einen „doppelten“ Vorsatz. Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, der das erkennende Gericht folgt.
Danach muss sich der Vorsatz des Handelnden zum einen auf die Verletzungshandlung beziehen. Zum anderen muss der Vorsatz aber auch den Verletzungserfolg umfassen. Es ist zumindest bedingter Vorsatz erforderlich.
Allein der Verstoß gegen zugunsten von Arbeitnehmern bestehende Schutzpflichten indiziert noch keinen Vorsatz bezüglich der Herbeiführung eines Arbeitsunfalls im Sinne des § 104 SGB VII. Es verbietet sich, die vorsätzliche Pflichtverletzung mit einer ungewollten Unfallfolge mit einem gewollten Arbeitsunfall oder einer gewollten Berufskrankheit gleichzusetzen.
So wird ein Arbeitgeber trotz eines Verstoßes gegen Arbeitsschutzvorschriften meistens darauf hoffen, es werde kein Unfall eintreten.
Diese Ausführungen sind einer Verallgemeinerung im Sinne eines Erfahrungssatzes auf tatsächlichem Gebiet allerdings nicht zugänglich.
Insbesondere gibt es umgekehrt nicht einen allgemeinen Erfahrungssatz, dass derjenige, der vorsätzlich eine zugunsten des Arbeitnehmers bestehende Schutzvorschrift missachtet, eine Schädigung oder eine mögliche Berufskrankheit des Arbeitnehmers nicht billigend in Kauf nimmt. Stets kommt es vielmehr auf die konkreten Umstände des Einzelfalles an. Es kann naheliegen, dass der Schädiger einen pflichtwidrigen Erfolg gebilligt hat, wenn er sein Vorhaben trotz starker Gefährdung des betroffenen Rechtsguts durchführt, ohne auf einen glücklichen Ausgang vertrauen zu können, und es dem Zufall überlässt, ob sich die von ihm erkannte Gefahr verwirklicht oder nicht.
Vorsatz enthält ein „Wissens“- und ein „Wollenselement“. Der Handelnde muss die Umstände, auf die sich der Vorsatz beziehen muss, gekannt bzw. vorausgesehen und in seinen Willen aufgenommen haben. Die Annahme eines bedingten Vorsatzes setzt voraus, dass der Handelnde die relevanten Umstände jedenfalls für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen hat. Die objektive Erkennbarkeit der Tatumstände reicht nicht aus. Bewusste Fahrlässigkeit liegt hingegen vor, wenn der Handelnde darauf vertraut, der Schaden werde nicht eintreten (Bundesarbeitsgericht – Urteil vom 20.06.2013 – 8 AZR 471/12; juris).
Der Beklagte hat gegen die bestehenden Schutzvorschriften vorsätzlich verstoßen.
Dies ergibt sich daraus, dass der Beklagte und seine Mitarbeiterinnen Frau T… und Frau H… sich unstreitig darüber einig waren, die herkömmlichen und nicht die vorgeschriebenen Sicherheitskanülen zu verwenden. Die Verwendung der bisherigen Kanülen war zwangsläufig mit der Entsorgung der benutzten Kanülen über das Recappingsystem verbunden.
Das erkennende Gericht ist aufgrund der gesamten Umstände davon überzeugt, dass der Beklagte hinsichtlich des Schadenseintritts mit bedingtem Vorsatz handelte, § 286 ZPO. Es liegt insbesondere eine Reihe von Umständen vor, die es ausschließen, dass der Beklagte auf einen glücklichen Ausgang vertrauen konnte. Vielmehr hat er es dem Zufall überlassen, ob sich die von ihm erkannte Gefahr verwirklichte oder nicht.
Der Tag des Unfalls war der erste Arbeitstag beim Beklagten, d.h., die Klägerin musste sich grundsätzlich in eine neue Praxis mit einer neuen Organisation und einer neuen Arbeitsweise eingewöhnen und sich dort zurechtfinden. So wurde in der Praxis des Beklagten Blut mittels eines Vakuumblutabnahmesystems entnommen, bei Dr. U… wurde ein anderes Entnahmesystem verwendet. Dies ergibt sich aus dem Vorbringen der Klägerin, das der Beklagte letztlich nicht bestreitet. Vielmehr hat er ausgeführt, die Klägerin sei von Frau T… in das bei ihm angewendete Blutabnahmesystem eingewiesen worden.
Die Klägerin befand sich noch in der Ausbildung, auch wenn diese sich bereits dem Ende näherte. So hatte sie, wie sich aus dem Zeugnis des Dr. U… ergibt, zwar auch bereits Blutentnahmen durchgeführt. Dies geschah indes mit einem anderen Blutentnahmesystem als dem in der Praxis des Beklagten.
Erschwerend kam hinzu, dass der Klägerin insbesondere keine Sicherheitskanülen zur Verfügung gestellt wurden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin Sicherheitskanülen verlangte. Diese hatten, da sie durch die TRBA 250 vorgeschrieben waren, auch ohne ein entsprechendes Verlangen der Klägerin bereit zu sein.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme waren zwar Sicherheitskanülen vorhanden. Diese befanden sich indes, wie die Zeugin M… aussagte, nicht griffbereit, sondern waren in einer Schublade verstaut, die, wie die Zeugin ausführte, eine Art kleines Lager beinhaltete. In einer anderen Schublade waren die Utensilien untergebracht, die im täglichen Betrieb verwendet wurden.
Die Klägerin wurde weder vom Beklagten noch von Frau T…, der der Beklagte die Klägerin anvertraut hatte, darauf hingewiesen, dass Sicherheitskanülen vorrätig waren. Insbesondere ist dies vom Beklagten nicht geltend gemacht worden. Angesichts des Umstandes, dass die ohne die Klägerin gefasste Entscheidung, entgegen der geänderten Schutzvorschriften die bisherigen Kanülen weiter zu benutzen, der Klägerin nicht bekannt war, wäre es zwingend notwendig gewesen, der Klägerin durch aktives Tätigwerden die Möglichkeit zu geben, auf die (vorhandenen) Sicherheitskanülen zuzugreifen.
Der Beklagte kann nicht damit gehört werden, es werde bestritten, dass die Klägerin, wie sie vorträgt, bei Herrn Dr. U… nur mit den Sicherheitskanülen gearbeitet habe.
Es ist bereits nicht erkennbar, welche rechtliche Relevanz dies vorliegend haben soll. Auch wenn dies der Fall gewesen sein sollte, entband dies den Beklagten nicht von seiner Verpflichtung, der Klägerin Sicherheitskanülen zur Verfügung zu stellen. Allenfalls hätte, sollte die Klägerin bereits bei Herrn Dr. U… die herkömmlichen Nadeln verwendet haben, dies dazu geführt, dass der Beklagte darauf hätte vertrauen dürfen, sie könne die Blutentnahme auch mit den nicht mehr zugelassenen Kanülen sicher durchführen. Die Verwendung von Sicherheitskanülen war bereits seit geraumer Zeit verpflichtend. Deshalb ist davon auszugehen, dass sie normalerweise in einer Arztpraxis verwendet wurden und werden. Der Beklagte hat sich insoweit bei der Klägerin indes nicht versichert. So macht er selbst nicht geltend, er habe die Klägerin hierzu befragt und die entsprechende Auskunft erhalten.
Dem Beklagten war daher zwangsläufig bekannt, dass die Klägerin bei der angewiesenen Blutabnahme Kanülen ohne Sicherheitsklappe verwendete. Dies entsprach der Handhabung beim Beklagten.
Der Umstand, der bei der Frage des Maßes des Verschuldens am schwersten wiegt, ist indes die Tatsache, dass die Klägerin unter diesen Umständen bei einem Patienten Blut abnehmen musste, der bekanntermaßen an Hepatitis C litt.
Zwar hat der Beklagte der Klägerin nicht persönlich die Anweisung erteilt, dem Patienten Blut zu entnehmen. Vielmehr erfolgte die Anweisung, wie üblich, über das interne System per Computer. Es kam allerdings nur die Klägerin als diejenige in Betracht, die dem Patienten Blut entnahm.
Frau T… schied hierfür aus. Sie war schwanger und durfte deshalb nicht nur selbst kein Blut abnehmen, sondern sich während der Blutentnahme nicht einmal im Labor aufhalten. Damit fiel sie auch als Betreuungsperson für die Klägerin aus, konnte ihr also nicht helfend zur Seite stehen. Vielmehr war die Klägerin bei der Blutabnahme auf sich allein gestellt.
Frau H… kam nicht in Frage, weil sie mit dem Beklagten bei der Patientenbehandlung mitging.
Da der Beklagte sonst keine Mitarbeiterinnen mehr beschäftigte, blieb lediglich die Klägerin übrig, um dem infizierten Patienten, wie angeordnet, Blut zu entnehmen.
Diese Umstände waren dem Beklagten bekannt. Insbesondere war er sich des Risikos der Blutentnahme bewusst. Dies ergibt sich daraus, dass er, wie er selbst ausführt, Frau H… „extra aus dem Sprechzimmer schickte“ mit der Aufforderung, aufzupassen. Gleichwohl ließ er die Klägerin die Blutentnahme durchführen, anstatt dies selbst zu übernehmen oder zumindest Frau H… hierfür kurzzeitig abzustellen. Es ist vor allem gerade nicht so, wie der Beklagte geltend macht, dass er am 24.05.2011 Vorsicht walten ließ und der Klägerin eine erfahrene Helferin zur Seite stellte. Frau T… war unbeschadet ihrer fachlichen Eignung wegen ihrer – dem Beklagten bekannten – Schwangerschaft für die Erfüllung wesentlicher Aufgaben einer Arzthelferin verwehrt.
Angesichts dieser Umstände ist es nach Auffassung des erkennenden Gerichts völlig ausgeschlossen, auf einen glücklichen Ausgang hoffen zu können.
Der Beklagte ist zum Ersatz des durch den Unfall entstandenen Schadens verpflichtet. Der Schadensersatzanspruch umfasst insbesondere den von der Klägerin geltend gemachten immateriellen Schaden, §§ 249 Absatz 1, 253 BGB.
Der Klägerin steht wegen der Verletzung der Gesundheit eine billige Entschädigung in Geld zu, § 253 Absatz 2 BGB.
Der unbestimmte Rechtsbegriff der „billigen Entschädigung“ meint sowohl nach dem Wortlaut als auch nach systematischer, historischer und teleologischer Auslegung eine angemessene Entschädigung, bei deren Bemessung der Tatrichter alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigen darf. Das Schadensrecht geht gemäß § 249 BGB von dem Grundsatz der Totalreparation aller von dem Geschädigten erlittenen Vermögensschäden aus. Demgegenüber sieht das Gesetz bei dem Ausgleich der immateriellen Schäden, mithin solcher Einbußen, die sich wegen der Art der verletzten Rechtsgüter jeder vermögensrechtlichen Bewertung entziehen, gerade keine starre Regelung, sondern eine billige Entschädigung vor, ohne dem Tatrichter hinsichtlich der zu berücksichtigenden oder berücksichtigungsfähigen Umstände Vorgaben zu machen. Dem liegt auch der Gedanke zugrunde, dass bei der zusätzlich zu dem Ausgleich des Vermögensschadens zu leistenden billigen Entschädigung der Gedanke des Ausgleichs im Allgemeinen nicht dazu führen soll, den Schädiger in nachhaltige Not zu bringen. Das Schmerzensgeld hat nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofs als auch des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundessozialgerichts und des Bundesarbeitsgerichts rechtlich eine doppelte Funktion. Es soll dem Geschädigten einen angemessenen Ausgleich bieten für diejenigen Schäden, für diejenige Lebenshemmung, die nicht vermögensrechtlicher Art sind (Ausgleichsfunktion). Es soll aber zugleich dem Gedanken Rechnung tragen, dass der Schädiger dem Geschädigten für das, was er ihm angetan hat, Genugtuung schuldet (Genugtuungsfunktion). Dabei steht der Entschädigungs- oder Ausgleichsgedanke im Vordergrund. Im Hinblick auf diese Zweckbestimmung des Schmerzensgeldes bildet die Rücksicht auf Größe, Heftigkeit und Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen die wesentlichste Grundlage bei der Bemessung der billigen Entschädigung. Für bestimmte Gruppen von immateriellen Schäden hat aber auch die Genugtuungsfunktion, die aus der Regelung der Entschädigung für immaterielle Schäden nicht wegzudenken ist, eine besondere Bedeutung. Dabei stehen die Höhe und das Maß der Lebensbeeinträchtigung ganz im Vordergrund. Bei den unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit zu berücksichtigenden Umständen hat die Rücksicht auf Größe, Heftigkeit und Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen stets das ausschlaggebende Moment zu bilden; der von dem Schädiger zu verantwortende immaterielle Schaden, die Lebensbeeinträchtigung steht im Verhältnis zu den anderen zu berücksichtigenden Umständen immer an der Spitze.
Daneben können aber auch alle anderen Umstände berücksichtigt werden, die dem einzelnen Schadensfall sein besonderes Gepräge geben, wie der Grad des Verschuldens des Schädigers, im Einzelfall aber auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschädigten oder diejenigen des Schädigers. Ein allgemein geltendes Rangverhältnis aller anderen zu berücksichtigenden Umstände lässt sich nicht aufstellen, weil diese Umstände ihr Maß und Gewicht für die Höhe der billigen Entschädigung erst durch ihr Zusammenwirken im Einzelfall erhalten (Bundesgerichtshof – Vereinigte Große Senate – Beschluss vom 16.09.2016 – VGS 1/16; juris).
Gemessen an diesen Grundsätzen steht der Klägerin nach Auffassung des erkennenden Gerichts ein Schmerzensgeld in Höhe von 150.000,00 € zu.
Hier war zunächst zu berücksichtigen, dass die Klägerin infolge der Infektion mit Hepatitis C auf Dauer unmittelbar gesundheitlich beeinträchtigt ist. Um die Hepatitis C zu behandeln, musste sie sich zweimal einer Interferonmedikation unterziehen. Diese Behandlungsphase dauerte bis Ende 2012. Bereits darin liegt eine einschneidende Lebensbeeinträchtigung.
Danach wird die Hepatitis C zwar als ausgeheilt betrachtet.
Die Klägerin litt aber nicht nur über ca. eineinhalb Jahre an der Hepatitis C, deren Folgewirkungen, insbesondere die längerfristigen Auswirkungen auf die Leber, offen sind.
Vielmehr erkrankte sie an rheumatoider Arthritis. Gerade die chronische rheumatische Arthritis führt bei der Klägerin zu einer erheblichen Lebensbeeinträchtigung.
Insoweit ist zunächst hervorzuheben, dass die Klägerin erst 20 Jahre alt war, als sich der Unfall ereignete. Dies ist ein Alter, in dem die Lebensplanung erst beginnt. Die Zukunftschancen sind bei der Klägerin in einer gravierenden Weise beeinträchtigt und reduziert. Dies betrifft nicht nur den beruflichen Bereich – die Klägerin ist zwischenzeitlich mit einem Grad von 80% schwerbehindert, teilweise erwerbsunfähig und kann den Beruf einer Arzthelferin nicht ausüben -, sondern vor allem auch den Bereich Ehe und Familie.
Der Beklagte bestreitet zwar, dass die Klägerin Probleme damit hat, eine längerfristige Partnerschaft einzugehen. Dass dies der Fall ist, liegt indes auf der Hand und bedarf keines weiteren Beweises, § 291 ZPO.
Einem potentiellen Partner wird an einer schwerkranken Frau nicht ohne weiteres gelegen sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Partner den Wunsch hat, eine Familie zu gründen.
Die Verwirklichung eines Kinderwunsches ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber erheblich reduziert.
Die Erkrankung der Klägerin – es handelt sich um eine Entzündung der Gelenke – ist mit starken Schmerzen sowie mit einer Einschränkung ihrer Beweglichkeit verbunden. Eine Besserung ist nicht zu erwarten.
Die Klägerin ist gehalten, wegen der Erkrankung verschiedene Medikamente einzunehmen. Dies sind insbesondere das Rheumamittel MTX sowie Mittel gegen die Schmerzen. Der Beklagte bestreitet dies nicht.
Das Medikament MTX steht seiner Wirkungsweise wegen einer Schwangerschaft entgegen bzw. birgt die Gefahr von Missbildungen des Fötus. Es muss deshalb vor einer Schwangerschaft abgesetzt werden, was wiederum die Rheumabeschwerden vergrößert.
Dazu kommen die im Gutachten attestierten psychologischen Beeinträchtigungen, die bis zu depressiven Phasen reichen.
Mit zu berücksichtigen ist ferner das hohe Maß des Verschuldens des Beklagten, nicht zuletzt seine fehlende Einsicht. Noch im letzten Schriftsatz vom 24.04.2017 versucht der Beklagte darzustellen, dass das in seiner Praxis verwendete System mindestens genauso sicher sei wie die Sicherheitskanülen, obwohl sich mit dem Unfall der Klägerin genau das Risiko verwirklicht hat, das mit den Sicherheitskanülen minimiert werden sollte.
Das Gericht hält aus diesen Gründen ein hohes Schmerzensgeld für angemessen und erforderlich.
Etwas anderes ergibt sich nicht aus der vom Beklagten zitierten Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom 06.05.2004 (6 U 179/01; juris).
Der dortigen Klägerin wurde ein Schmerzensgeld von 36.000,00 € zugesprochen. Sie hatte sich als Reinigungskraft in einem Krankenhaus an einer mit Hepatitis C kontaminierten Nadel gestochen, die vorschriftswidrig in einem Müllsack entsorgt worden war. Zu dem Zeitpunkt war sie 34 Jahre alt, war verheiratet und hatte zwei Kinder. Der Heilungsprozess dauerte ca. drei Jahre, danach konnte die dortige Klägerin wieder ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Im vorliegenden Fall sind die Auswirkungen der Verletzung weitaus gravierender, da die Klägerin nicht nur an Hepatitis C, sondern darüber hinaus an der rheumatoiden Arthritis erkrankte. Dabei fällt insbesondere der darauf beruhende Gesichtspunkt der Lebensplanung ins Gewicht.
Schließlich führt auch der Gesichtspunkt eines Mitverschuldens (§ 254 BGB) nicht zu einem anderen Ergebnis.
Der Beklagte macht zwar geltend, dass die Klägerin beim Einführen der Nadel in das Sicherheitsbehältnis abgerutscht sei, sei nur unter Außerachtlassen der erforderlichen Sorgfalt möglich. Der Durchmesser der Öffnung sei so groß, dass ein problemloses Einführen der Nadel völlig unproblematisch möglich sei. Die Klägerin treffe daher ein Mitverschulden.
Dies ist zu verneinen.
Das Verbot des Recappings resultiert daraus, dass dieses Entsorgungssystem als nicht sicher angesehen wurde. Es ist gerade der Sinn der Sicherheitskanüle, Verletzungen der vorliegenden Art zu verhindern. Der Beklagte stellte der Klägerin keine Sicherheitskanülen zur Verfügung, vielmehr war das Recappinggefäß in Gebrauch.
In der Übernahme einer gefährlichen Arbeit kann nicht ohne weiteres ein mitwirkendes Verschulden gesehen werden. Führt der Arbeitnehmer aufgrund der Weisung des Arbeitgebers oder seines Vertreters eine gefährliche Arbeit aus, so ist regelmäßig ein Mitverschulden zu verneinen (Bundesarbeitsgericht – Urteil vom 23.03.1983 – 7 AZR 526/80; juris).
Dies gilt vor allem im vorliegenden Fall. So führt der Beklagte insbesondere nicht aus, was die Klägerin alternativ hätte tun sollen.
Das Ersturteil war daher aufzuheben und der Klägerin das Schmerzensgeld in dieser Höhe zuzusprechen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Absatz 1 ZPO.
Für die Zulassung der Revision besteht kein gesetzlicher Anlass, § 72 Absatz 2 ArbGG.